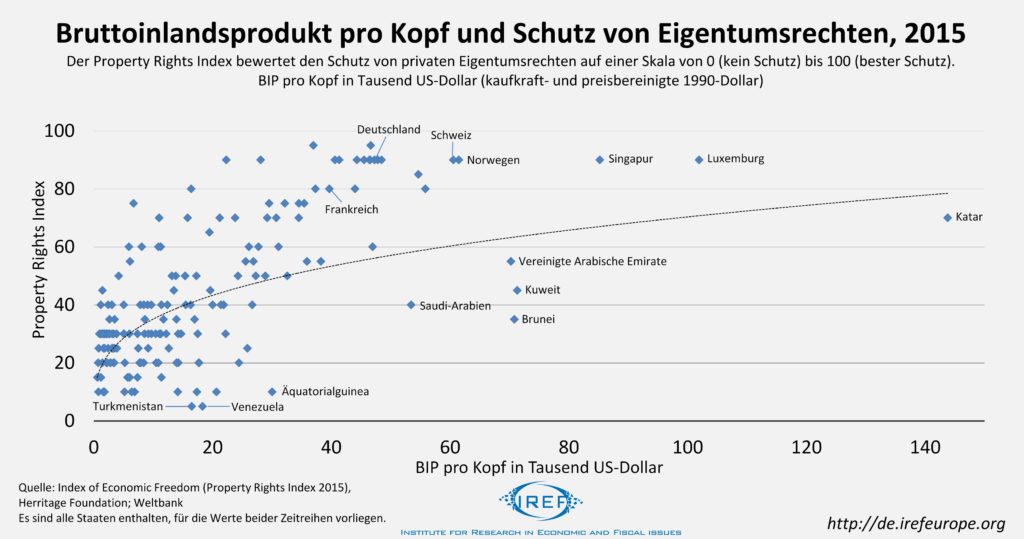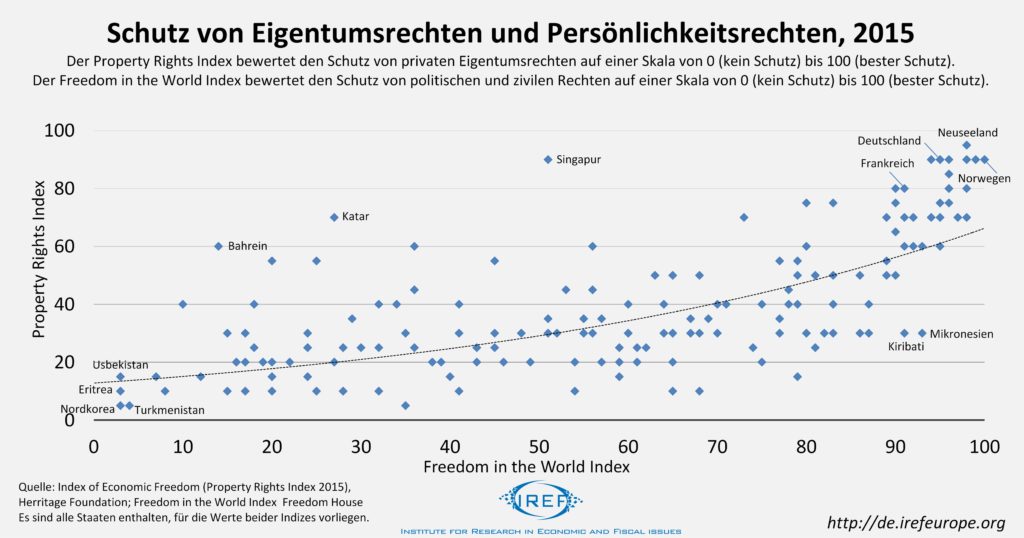Photo: Tom Thai from Flickr (CC BY 2.0)
Eine Studie der Unternehmensberatung Ernst & Young hat gerade die beruflichen Pläne von Studenten abgefragt. 32 Prozent der befragten Studenten wollen nach ihrem Studium in den Öffentlichen Dienst wechseln. Lediglich 9,9 Prozent wollen sich selbstständig machen. Wahrscheinlich drückt nichts den aktuellen Gemütszustand junger Menschen in diesem Lande besser aus als diese beiden Zahlen. Der Staatsdienst ist sicher und auskömmlich, die Selbstständigkeit gilt als risikobehaftet und für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weniger gut geeignet. Wenn man bedenkt, dass unter der Bedingung von Mehrfachnennungen auch noch 23 Prozent der Studenten gerne in Kultureinrichtungen arbeiten würden, die ja ebenfalls meist staatlich finanziert sind, und weitere 18 Prozent in die staatlich finanzierte Wissenschaft, dann wird einem angst und bange.
Denn für die Zukunftsfähigkeit einer Gesellschaft ist das ein Alarmsignal. Die Funktionsfähigkeit des Öffentliche Dienstes ist für das Vorankommen einer Gesellschaft und ihres Wohlstandes wahrscheinlich nicht völlig zu vernachlässigen. Man muss dazu nur nach Griechenland schauen, um das hiesige Funktionieren einer Bürokratie auch ein wenig schätzen zu lernen. Dennoch sollten sich in einer offenen Gesellschaft, die zwangsläufig auf einer marktwirtschaftlichen Ordnung beruht, die besten Kräfte selbstständig machen, ihre Ideen umsetzen und nicht nur ihre Energie im Verwalten des Staates vergeuden.
Zum Wohlstand des Einzelnen und einer Gesellschaft insgesamt bedarf es einer Wertschöpfung. Wohlstand entsteht nur, wenn Unternehmer Produkte oder Dienstleistungen besser machen als bisher. Das nennt man dann Wachstum. Es muss also etwas produziert und hergestellt werden, das am Markt Käufer findet. Der öffentliche Dienst ist natürlich auch Innovation. Doch diese Innovation konzentriert sich in der Regel auf neue Vorschriften, Verordnungen und Bürokratie. Sie lähmen den Fortschritt der echten Innovationen in einer freien Marktwirtschaft.
Wahrscheinlich ist das Kind erstmal in den Brunnen gefallen. Die Entwicklung und die Präferenzen der Studenten von heute sind das Ergebnis der falschen Bildungsanstrengungen von gestern. Woher sollen die Studenten die Faszination der Marktwirtschaft und des darin agierenden Unternehmers kennen, wenn in Erdkundebüchern lieber über „Fair Trade“ zur Armutsbekämpfung anstatt über Freihandel und seine wohlstandsfördernde Wirkung zu lesen ist. Dieser moderne Ablasshandel, der moralisierend jedem Käufer ein schlechtes Gewissen einredet, ist inzwischen in die obersten Etagen der Politik vorgedrungen. Wenn selbst der amtierende Wirtschaftsminister sich zum Beispiel für weniger Freihandel ausspricht, nichts Anderes ist seine Ablehnung von TTIP, dann ist er selbst das fleischgewordene Produkt des Bildungsversagens der 1970er Jahre. Er hat das verinnerlicht, was er damals im Erdkundeunterricht eingebläut bekam, dass die Wirtschaft ein Nullsummenspiel sei. So wie es ein Schulbuch für Gesellschaftslehre, Geschichte und Erdkunde an Haupt- und Gesamtschulen (Terra Band 9/10), wahrscheinlich auch schon zu seiner Schulzeit formuliert hat: „Dem Zuviel an Nahrungsmitteln in den Industriestaaten steht ein Mangel in vielen Entwicklungsländern, vor allem in Afrika, gegenüber.“ Ergo, man muss es nur besser verteilen.
Sigmar Gabriel werden wir wohl nicht mehr bekehren können, da bleibt Hopfen und Malz verloren. Doch die Schüler von heute, könnten die Unternehmer von morgen sein. Sie könnten ein neuer Werner Siemens, ein Robert Bosch oder ein Ferdinand Porsche sein. Es ist schon etwas her, aber es gab auch Zeiten in diesem Land, wo Unternehmerpersönlichkeiten mit ihren Ideen Unternehmen mit Weltgeltung geschaffen haben. Es ist nicht selbstverständlich, dass diese Unternehmer heute aus Amerika kommen und Bill Gates, Marc Zuckerberg oder Elon Musk heißen.
Es sind lange Entwicklungsströme, die eine Gesellschaft zum Guten oder Schlechten verändern und es sind wenige, die diesen Prozess beeinflussen. In erster Linie hat dies natürlich mit dem Elternhaus zu tun, aber auch mit einer frühen schulischen Prägung. Wie wahrscheinlich ist es, wenn der größte Teil der heutigen Studenten den öffentlichen Dienst präferiert, dass diese dann als spätere Lehrer, Pädagogen oder Erzieher ihren Anvertrauten die Vorzüge der internationalen Arbeitsteilung, das Bild eines erfolgreichen Unternehmers oder des mündigen Konsumenten vermitteln? Wahrscheinlich werden sie eher die Unternehmer als vermeintliche Ausbeuter und Steuerhinterzieher darstellen und den einzelnen Bürger als willenlosen Konsumenten, der von Werbung und Verlockungen so vernebelt ist, dass er ohne staatliche Hilfe im Dschungel der Marktwirtschaft nicht mehr zurechtkommt.
Die Darstellung von Marktwirtschaft und Unternehmertum in Schulbüchern ist daher eine fundamentale Aufgabe, die nicht unterschätzt werden darf. Es gibt so eindrucksvolle Texte und Beispiel dafür, wie es gehen könnte. Einer dieser Texte ist der bereits 1958 von Leonard Read verfasste „Ich, der Bleistift“. Darin wird anhand der Produktion eines Bleistiftes anschaulich gezeigt, dass niemand das umfassende Wissen haben kann, wie ein Bleistift hergestellt wird. Dafür braucht es das Wissen ganz vieler. Die einen kennen sich mit dem Holz, seiner Be- und Verarbeitung aus. Die anderen kennen sich mit dem Abbau und der Verarbeitung von Graphit aus.
Wiederum andere wissen, wie der Radiergummi und die Metallfassung hergestellt werden und wieder andere haben das Know-how, wie dies alles zu einem Bleistift zusammengefügt wird. In jedem Teilbereich der Herstellung gibt es wieder unzählige Beteiligte, die ihr Wissen zur Verfügung stellen: vom Transportunternehmer über die Buchhalterin bis zum Kaffeebauern. Dies alles kann nur arbeitsteilig erfolgen, indem sich einzelne Unternehmer spezialisieren. Es kann umgekehrt nicht zentral geplant werden, weil keine Zentralbehörde das umfassende Wissen haben kann, wie ein Bleistift hergestellt, in welchen Mengen, an welchem Ort und zu welchem Preis er zur Verfügung stehen soll. Gerade hat das Berliner Prometheus-Institut dazu das Planspiel „Unsere Wirtschaft – Verständlich erklärt an einem Tag“ herausgebracht, das jungen Menschen dies spielerisch nahe bringt.
Wenn es die Beamten in den Kultusbürokratien nicht hinbekommen, müssen wir es eben selbst tun. Ganz im Sinne von Wilhelm von Humboldt: „Gleichförmige Ursachen haben gleichförmige Wirkungen: je mehr also der Staat mitwirkt, desto ähnlicher ist nicht bloß alles Wirkende, sondern auch alles Gewirkte.“