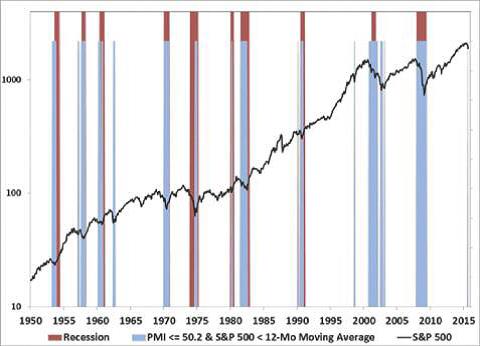Photo: Kentaro Ohno from Flickr (CC BY 2.0)
Von Robert Benkens, Student der Politikwissenschaften, Volkswirtschaftslehre und Germanistik.
Der postmoderne Glaube ist von einer Absage an alte Bindungen geprägt. Dazu zählt auch die Aufhebung nationalstaatlicher durch suprastaatliche Ordnungskonzepte, um den kosmopolitischen Weltbürger zu schaffen. Obwohl liberale Grundsätze und Werte per definitionem universell sind, können sie nur in kleinen politischen Einheiten mit Leben und Sinn gefüllt werden. Deshalb brauchen wir heute eine Stärkung des subsidiären Denkens – nicht nur in technischen Ordnungsfragen von Wirtschaft und Staat, sondern vor allem für die Vitalisierung des gesellschaftlichen Zusammenhalts.
Doch bevor auf die aktuelle gesellschaftliche Bedeutung der Subsidiarität angesichts globaler Entgrenzung eingegangen werden kann: Auf welchem wirtschaftlichen und politischen Ideenhintergrund fußen die subsidiären Grundsätze eigentlich und was sollten sie bewirken? Das Prinzip der Subsidiarität geht vor allem auf die christliche Soziallehre zurück und fand seinen Ausdruck in ordnungs- und wirtschaftspolitischen Schriften zur sozialen Marktwirtschaft: Demnach soll alles, was auf der untersten Ebene einer Gesellschaft – etwa in der Familie oder der Gemeinde – entschieden und geregelt werden kann, nicht auf höhere Ebene verlagert werden. Nur wenn die untergebene Einheit sich aus eigenen Kräften sich nicht mehr selbst helfen kann, ist die übergeordnete gefragt.
Hierdurch wird die Eigenverantwortung und somit der wirtschaftliche Wettbewerb gestärkt, was zu Wohlstand führt – ohne dass sozial Schwache aufgrund mangelnder Hilfe (lat. subsidium) auf der Strecke bleiben und nur das Recht des Stärkeren gilt. Ganz im Gegenteil: Einerseits sorgt schon der Wettbewerb an sich für eine permanente Infragestellung wirtschaftlicher Machtpositionen und macht somit potentiell Wohlstand für alle Menschen möglich. Andererseits steht im Notfall für sozial Schwache aber auch die übergeordnete Einheit – meistens der Sozialstaat – ein. Das ist aber nur insofern angesagt, als dass die Bedürftigen auch wirklich bedürftig sind und nicht von Transfers und Subventionen abhängig bleiben.
Eine staatliche Rundumversorgung und Wirtschaftslenkung ist mit dem subsidiären Gedanken also nicht vereinbar, denn der Staat kann keinen Wohlstand oder Arbeitsplätze schaffen, sondern den Rechtsrahmen für Wettbewerb sowie gegen Korruption setzen, weiterhin kann er die notwendige soziale Hilfe zur Selbsthilfe nur garantieren, wenn vorher die notwendigen finanziellen Mittel von einer starken Wirtschaft erarbeitet wurden. Eine Politik, die diese elementaren subsidiären Grundsätze missachtet, führt zu immer mehr Staatsausgaben, zu immer neuen Schulden, zu Abhängigkeit von Finanzmärkten und schließlich zu Umverteilung von unten nach oben – denn die Schulden der Vielen sind die Guthaben der Wenigen.
Irrweg des Zentralismus
Zu diesen fatalen wirtschaftlichen Auswirkungen kommt es zudem umso eher mit umso weitreichenderen Auswirkungen, je größer der politische Machtbereich wird. So soll die politische Macht in Europa nun zur „Harmonisierung“ unterschiedlicher Wirtschafts- und Staatssysteme als Antwort auf die Krise gestärkt werden. Allein: Mehr Zentralismus kann keine Probleme lösen, die durch Zentralismus geschaffen wurden. In gewisser Weise manövriert sich zentralistische Politik immer in ein Dilemma. Denn einerseits nimmt sie den untergeordneten politischen Einheiten die Freiheit, selbst über ihr Fortkommen zu entscheiden. Andererseits halst sich eine solche Politik aber auch eine Verantwortung für diese Einheiten auf und muss mit immer mehr Erlassen und Gesetzen bis ins kleinste Dorf oder auch ins Wohnzimmer hineinregieren. Hinzu kommt: Je unterschiedlicher diese Einheiten strukturell und kulturell geschaffen sind, desto weniger werden einheitliche Maßnahmen auf unterschiedliche Bedingungen abgestimmt sein. Gleichzeitig ersetzt auf Seite der bevormundeten kleineren Einheiten das Anspruchsdenken gegenüber der Zentrale die Kooperationsbereitschaft gegenüber den anderen – ebenfalls bevormundeten – Einheiten: Denn wenn schon die Selbstbestimmung immer mehr zu Gunsten der Befugnisse der Zentrale verschoben wird, dann darf es bitte auch immer etwas mehr für einen selbst und immer etwas weniger für die anderen sein.
Die Folgen eines solchen Großversuchs können aktuell beobachtet werden: Schuldenhaftung für die einen, Spardiktat für die anderen – Zwietracht auf allen Seiten. Die große europäische Idee, die im Sinne des subsidiären Prinzips beispiellosen Wohlstand und Frieden durch wirtschaftlichen Handel und politische Kooperation geschaffen hat, verkommt so immer mehr zur Karikatur ihrer selbst. Die EU selber hat sich seit jeher das Subsidiaritätsprinzip als Ordnungsprinzip zwischen den Mitgliedsstaaten und der suprastaatlichen Ebene auf die Fahnen geschrieben. Sie muss deshalb nicht aufgelöst oder abgewickelt, sehr wohl aber subsidiär reorganisiert werden.
Die so häufig in Sonntagsreden proklamierte europäische Idee verkommt zur hohlen Phrase, wenn die Vielfalt Europas nicht mehr im gegenseitigen Miteinander gelebt, sondern nur noch superstaatlich betreut und verwaltet wird. Die in ihrer institutionellen Eigenlogik der immer weiteren Vereinheitlichung gefangene EU muss sich auf ihre Wurzeln besinnen: Die Einigung Europas gelang nicht deshalb, weil sie von einem sanktionierenden Super-Staat aufgezwungen wurde oder weitreichende Ansprüche gegen einen umverteilenden Super-Staat erhoben werden konnten, sondern weil sie durch wirtschaftlichen Handel, kulturellen Austausch und politische Kooperation der europäischen Länder notwendig und möglich wurde.
Zusammenwachsen statt Vereinheitlichung
Doch dieses Prinzip darf nicht auf ein rein marktwirtschaftliches Kosten-Nutzen-Kalkül oder auf ein politisch-bürokratisches Weisungsverhältnis in der EU reduziert werden. Denn was für die subsidiäre Ordnung auf der zwischenstaatlichen Ebene in Europa richtig ist, gilt auch für die europäischen Gesellschaften selber: Durch die Freiheit zur Selbstbestimmung in kleinen politischen Einheiten wird das so wichtige Verantwortungsbewusstsein der Menschen gestärkt, sowohl für sich selbst als auch für die Familie, den Verein oder die Gemeinde. Eigensucht ist nicht nur Folge einer wachsenden Konsumfixierung, sondern vor allem aufgelöster gesellschaftlicher Bindungen. Wo Menschen nicht mehr aufeinander, sondern nur noch auf den paternalistischen Staat angewiesen sind, kann kein gemeinsamer Wertekanon oder Bürgersinn entstehen.
Gerade aber offene und tolerante Gesellschaften brauchen trotz aller Unterschiede ein Mindestmaß an gemeinsamen kulturellen Werten, gerade um gegenüber der Intoleranz von Extremisten und Fundamentalisten stark zu sein. Der liberale Rechtsstaat schreibt zwar unmissverständlich die Grundsätze der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vor, den vielbeschworenen gesellschaftlichen Zusammenhalt kann aber weder er noch sein Pendant – der Sozialstaat – leisten. Oder wie es der ehemalige Bundesverfassungsrichter Böckenförde ausdrückte: „Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann.“ Denn wirklicher Zusammenhalt kann nur im Kleinen und auch nur dann gelingen, wenn die Individuen auch ein vitales Interesse an Bindungen haben, die notwendig sind, wenn sich nicht alle auf einen allzuständigen Vater-Staat verlassen können.
Eine Stärkung des Subsidiaritätsgedankens bedeutet aber gerade keinen nationalistischen Rollback – zumal dieser im besten Falle mit Isolation und im schlimmsten Falle mit Expansion einherginge, beides widerspricht subsidiären Grundsätzen in krassester Form. Niemals und nirgendwo war eine fundamentalistisch oder chauvinistisch legitimierte Gesellschaftsordnung besser und vor allem menschenwürdiger – davon kann sich jeder „Systemkritiker“ noch heute außerhalb Europas leider nur allzu häufig überzeugen. Eine Stärkung der Subsidiarität und die damit einhergehende Bedeutung der dezentralen, demokratisch-souveränen Gemeinschaften kann also gar keine Absage an europäische Kooperation bedeuten. Natürlich muss sich der Mensch von nationalistischen Bindungen, die die Freiheit bedrohen oder gar ersticken, befreien. Die Freiheit des Einzelnen ist schließlich der höchste Wert in einer liberalen Gesellschaft. Aber Freiheit wird in Großbritannien anders als in Griechenland verstanden, sie hat in Frankreich andere Institutionen und Strukturen hervorgebracht als in Deutschland.
Ein abstrakter europäischer Supranationalismus kann deshalb nicht die Lösung sein. Nicht nur, weil die planwirtschaftliche Harmonisierung unterschiedlichster Wirtschafts-, Rechts- und Sozialsysteme ökonomisch sinnlos ist und politisch zu enormen Spannungen führt, sondern weil diese Systeme trotz aller Gemeinsamkeiten auf den jeweiligen historisch gewachsenen kulturellen Bedingungen der einzelnen europäischen Gesellschaften beruhen, die nicht einfach per supranationaler Direktive ausgeblendet werden können.
Trotz der wirtschaftlich und politisch globalisierten Welt sind auch heute noch die demokratischen Nationalstaaten Grundlage für eine stabile Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung, die durch die zweifellos notwendige europäische und internationale Kooperation ergänzt, nicht aber ersetzt werden sollten.
Natürlich sind gerade liberale Gesellschaften nie starr und verändern sich ständig, dennoch muss dieser Veränderungswille – möglicherweise hin zu einer europäischen Identität – von unten erfolgen und darf nicht von oben durch Vereinheitlichung erzwungen werden. Deshalb wird das Subsidiaritätsprinzip in Zeiten von technokratischen Krisengipfeln heute mehr denn je benötigt: Wir brauchen moderne Bürgergemeinschaften, wo wirtschaftlicher Wohlstand und sozialer Zusammenhalt in dezentralen Strukturen gewährleistet werden. Denn nur eine solch subsidiäre Ordnung hält nicht nur die Auswirkungen von Machtmissbrauch und Misswirtschaft als Folgen des Zentralismus in Grenzen, sondern festigt auch jenseits von politischen Sonntagsreden den Zusammenhalt in und zwischen den europäischen Gesellschaften.
Erstmals erschienen in NovoArgumente.