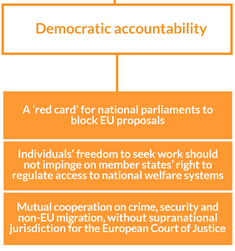Photo: Tonya Ammon from Flickr (CC BY 2.0)
Von Dr. Titus Gebel, Unternehmer, Mitgründer der Deutschen Rohstoff AG
Langsam aber sicher gewinnt die Erkenntnis Raum, dass die Probleme Deutschlands nicht nur an den handelnden Personen liegen, sondern möglicherweise der Konstruktion des deutschen demokratischen Systems geschuldet sind. Früher oder später wird daher die Diskussion über eine Systemreform an Fahrt gewinnen[1]. Erwähnt man in diesem Zusammenhang Gesprächspartnern gegenüber, dass die politische Ordnung Liechtensteins möglicherweise als Vorbild für Deutschland dienen könnte, erntet man in der Regel Verwunderung oder Spott. Bohrt man etwas tiefer, um die Kenntnisse der Betreffenden über Liechtenstein abzufragen, ergibt sich in der Regel: wenig bis gar keine[2].
Das Fürstentum Liechtenstein hat keine gemeinsame Grenze mit Deutschland, es ist zwischen der Schweiz und Österreich als Binnenstaat „eingeklemmt“. Das Staatsgebiet umfasst nur 160 Quadratkilometer, damit ist Liechtenstein der sechstkleinste Staat der Welt. Das Land hat 37.000 Einwohner, davon 34% (meist deutschsprachige) Ausländer. Hauptstadt ist Vaduz, die alleinige Amtssprache ist Deutsch. Ein souveräner Staat ist Liechtenstein seit der Auflösung des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation im Jahre 1806. Das Fürstentum hat keine eigene Währung, sondern benutzt den Schweizer Franken und bildet mit der Schweiz auch eine Zollunion. Liechtenstein ist aber, anders als die Schweiz, nach entsprechender Volksabstimmung Mitglied im Europäischen Wirtschaftsraum geworden, d.h. es gilt Waren-, Dienstleistungs-, Kapital- und Personenfreizügigkeit unter den Mitgliedsstaaten (alle EU-Staaten, Norwegen, Island und Liechtenstein), wobei letztere von Liechtenstein auf 64 neue Aufenthaltsgenehmigungen pro Jahr eingeschränkt ist. Das Fürstentum ist kein Mitglied der EU, aber seit 2011 dem Schengen-Raum angehörig.
Vorbild Liechtenstein?
Entgegen landläufiger Meinung ist das Fürstentum kein Operettenstaat, der vom Briefmarkenverkauf und windigen Finanzgeschäften lebt. Es handelt sich vielmehr um ein hochindustrialisiertes Land mit stark diversifizierter Wirtschaft, dessen Hauptwertschöpfungszweig die verarbeitende Industrie darstellt, insbesondere der Maschinenbau[3]. In Liechtenstein arbeiten etwa genauso viele Menschen wie das Land Einwohner hat! Zahlreiche Schweizer, Österreicher und Deutsche pendeln ins Fürstentum zum Broterwerb. Trotz seiner Kleinheit kann Liechtenstein mit Weltmarktführern aufwarten, bekannt sind etwa HILTI (Bohrmaschinen) oder IVOCLAR (Medizintechnik). Etwa 40% der Beschäftigten arbeiten im Industriesektor, damit gehört Liechtenstein zu den am stärksten industrialisierten Ländern der Welt[4]. Zum Vergleich: in der Finanzindustrie arbeiten weniger als 10% der Beschäftigten. Mit einem Unternehmen pro neun Einwohner weist Liechtenstein vermutlich die höchste Unternehmerdichte der Welt auf. Das Bruttoinlandsprodukt pro Erwerbstätigen beträgt sagenhafte 132.000 EUR[5] und liegt damit in der absoluten Weltspitze, nahezu doppelt so hoch wie Deutschland mit 68.000 EUR[6]. Liechtenstein hat kaum Kriminalität und ist weltweit eines der wenigen Länder ohne Staatsverschuldung. Es muss also irgendetwas richtig machen. Allein daher lohnt ein Blick auf das politische System des Landes.
Liechtenstein ist keine konstitutionelle Monarchie im herkömmlichen Sinne. Vielmehr handelt es sich um ein weltweit einmaliges Mischsystem zwischen direkter Demokratie und parlamentarisch-konstitutioneller Erbmonarchie, wobei das direktdemokratische Element soweit geht, dass die Monarchie insgesamt abgewählt werden kann. Staatsoberhaupt ist das männliche Oberhaupt der Familie von Liechtenstein, aktuell Fürst Hans-Adam II. Er hat im Jahre 2004, einer Familientradition folgend, im Alter von 60 Jahren die Regierungsgeschäfte an seinen ältesten Sohn, den Erbprinzen Alois von Liechtenstein abgegeben, bleibt aber formell Staatsoberhaupt. Daneben gibt es eine Regierung, ein Parlament (genannt Landtag), elf Gemeinden und eine unabhängige Justiz. Schließlich sind die Bürger seit Anfang des 20. Jahrhunderts mit direktdemokratischen Mitbestimmungsrechten nach Schweizer Vorbild ausgestattet.
Souveränität neu gedacht
Im Jahre 2003 wurde per Volksabstimmung nach zehnjähriger Diskussionen eine bedeutende Verfassungsreform angenommen, welche die Rechte der Bürger, der Gemeinden und des Monarchen –jeweils zulasten von Parlament und Regierung – gestärkt haben. Die Gründe für diese Änderungen sind instruktiv, da sie grundlegende Probleme von Parlamentarismus und Demokratie beleuchten.
In den 1990er Jahre hatte sich in Liechtenstein eine Verfassungswirklichkeit ausgebildet, in der die Politiker und Parteien, welche die Landtagsmehrheit und die Regierung stellten, zunehmend Befugnisse an sich zogen, die in der Verfassung entweder klar dem Fürsten zugewiesen oder deren Zuweisung unklar war. Teilweise wurden sogar Gesetze ohne die verfassungsmäßig notwendige Unterschrift des Fürsten veröffentlicht. Hans-Adam II. war damit nicht einverstanden. Er argumentierte, dass seine verfassungsmäßigen Kompetenzen mit den realen übereinstimmen müssten. Solange eine Mehrheit der Liechtensteiner die existierende monarchische Staatsform befürworte, sei es die Pflicht des Fürsten, seine verfassungsmäßigen Rechte wahrzunehmen. Der Landtag könne sich nicht einfach an die Stelle des Ko-Souveräns Volk setzen, nur weil er von diesem gewählt worden ist. Andererseits solle das Volk auch ihn legitimieren und notfalls die Befugnis haben, die Monarchie abzuschaffen. In den Folgejahren gab es diverse Auseinandersetzungen über die Neugestaltung der Verfassung einschließlich Demonstrationen. Schließlich einigten sich die beteiligten Organe darauf, Vorschläge zu einer Verfassungsreform zu machen[7]. Hochinteressant ist die Begründung, die Hans-Adam II. für seinen letztlich erfolgreichen Änderungsvorschlag machte:
Er führte aus, dass beide Souveräne, das Volk und der Fürst, aus praktischen Gründen die Staatsaufgaben an kleinere Gruppen delegieren müssten (Politiker, Parteien, Verwaltung), die in der Praxis dann eine überproportionale Bedeutung bekämen, sich in „Oligarchien“ verwandelten. Diese aber versuchten, ihre eigenen Interessen auf Kosten der Interessen aller anderen zu vergrößern. Aufgrund innerer Interessenkonflikte wären sie zunehmend weniger in der Lage wichtige, aber unpopuläre Entscheidungen treffen.
Es sei Aufgabe des Monarchen, darüber zu wachen, dass die demokratischen und rechtsstaatlichen Institutionen durch die Oligarchie nicht geschwächt und Staatsinteresse vor Partieinteresse gestellt werde. Langfristig werde der Monarch diese Aufgabe nur wahrnehmen können, wenn er wisse, dass die Mehrheit des Volkes ihn dabei unterstütze. Volk und Monarchie als die schwächeren Elemente seien die natürlichen Verbündeten gegenüber dem stärksten Element im Staat, der Oligarchie.[8]
Demokratie ist keine Mehrheitsherrschaft
Er wies gleichzeitig darauf hin, dass er gegebenenfalls auch gegen eine Volksmehrheit sein Veto einlegen müsse. Zu berücksichtigen sei, dass die Mehrheit nicht immer Recht habe und es Aufgabe des Fürsten sei, die Rechte der Minderheiten und der Schwachen zu schützen sowie das langfristige Wohl von Volk und Land zu verteidigen. Sollte dies aber vom Volk nicht gewollt sein, dann solle gemäß dem Prinzip des Selbstbestimmungsrechts das Volk das letzte Wort haben, ohne Rücksicht auf die Wünsche des Fürsten und in der Lage sein, diesem sein Misstrauen auszusprechen oder die Monarchie ganz abzuschaffen[9].
Kurz gesagt, die jeder Demokratie innewohnende Tendenz zur Parteienherrschaft und Selbstbedienung der politischen Klasse muss durch Organe (hier: Monarch, Bürger) eingeschränkt werden, die über relevante eigene Kontroll- und Mitgestaltungsrechte verfügen. Der Gefahr einer schrankenlosen Mehrheitsherrschaft in der direkten Demokratie muss aber entsprechend begegnet werden. In seinem Werk „Der Staat im dritten Jahrtausend“ weist Hans Adam II. darauf hin, dass für eine derartige Konstruktion keine Monarchie erforderlich ist. Ein direkt vom Volk gewählter Präsident könnte dieselbe Aufgabe wie der Fürst in Liechtenstein übernehmen[10].
Es gibt im liechtensteinischen System – neben einer unabhängigen Justiz – seither eine Vielzahl von Checks and Balances, welche machtbegrenzend wirken:
- Gleich drei Organe haben das Recht, Gesetzesinitiativen einzubringen (Fürst, Landtag, Volk).
- Regierungsmitglieder dürfen nicht gleichzeitig Parlamentsabgeordnete sein.
- Jedes Gesetz unterliegt der Volksabstimmung, sofern der Landtag oder drei Gemeinden oder mindestens 1.000 Bürger dies verlangen.
- Jeder Staatsvertrag (etwa Beitritt zu supranationalen Organisationen) unterliegt der Volksabstimmung, sofern der Landtag oder vier Gemeinden oder mindesten 1.500 Bürger dies verlangen.
- Der Fürst kann gegen Gesetze durch Nichtausfertigung sein Veto einlegen, auch wenn diese aufgrund von Volksabstimmungen zustande gekommen sind.
- Der Fürst kann einzelne Regierungsmitglieder oder die Regierung insgesamt ohne Angabe von Gründen entlassen.
- Das Volk kann das Parlament auflösen.
- Das Volk kann dem Monarchen das Misstrauen aussprechen oder die Monarchie insgesamt abwählen.
- Die Richter werden von einem Gremium aus Fürstlichen Mitgliedern und Landtagsabgeordneten dem Landtag zur Wahl vorgeschlagen. Lehnt dieser ab, entscheidet eine Volksabstimmung.
- Jede Gemeinde kann jederzeit aus dem Staatsverband austreten, wenn die Mehrheit der Gemeindeeinwohner dies beschließt.
Vergleichen wir das mit der Bundesrepublik Deutschland (Gemeinde = Länder, Fürst = Bundespräsident):
- Nur Bundestag und die Ländervertretung Bundesrat haben das Recht zu Gesetzesinitiativen auf Bundesebene.
- Regierungsmitglieder dürfen gleichzeitig Bundestagsmitglieder sein.
- Weder Bürger noch Länder haben auf Bundesebene das Recht, Volksabstimmungen über Gesetze zu verlangen. Lediglich der Bundesrat kann seine Zustimmung zu bestimmten Gesetzen verweigern.
- Dasselbe gilt für Staatsverträge, selbst wenn dadurch Souveränität abgegeben wird. Bürgermitwirkung ist nicht möglich.
- Der Bundespräsident hat theoretisch ein Vetorecht durch Nichtausfertigung von Gesetzen.
- Nur der Bundestag selbst kann die Regierung abwählen.
- Der Bundestag kann nur dann vom Bundespräsidenten aufgelöst werden, wenn keine Kanzlermehrheit zustande kommt.
- Der Bundespräsident kann unter bestimmten Voraussetzungen des Amtes enthoben werden, aber nur auf Veranlassung von Bundestag und Bundesrat.
- Alle Richter werden von der Exekutive ausgewählt und ernannt. Lediglich für die höchsten Gerichte erfolgt eine Wahl durch Gremien von Bundestag und Ländern.
- Weder Länder noch Gemeinden haben ein Sezessionsrecht. Lediglich bei der Neugestaltung der Ländergrenzen innerhalb Deutschlands dürfen die Bürger mitbestimmen.
Schon aus diesem Vergleich wird deutlich, dass im Grunde nur die Länder über den Bundesrat eine gewisse Gegenmacht gegen die Bundestagsmehrheit bilden können, wobei auch Bundesrat und Länderregierungen fest in der Hand der Parteien sind. Die Bürger haben keinerlei Mitgestaltungs- oder Kontrollbefugnisse. Der nicht vom Volk gewählte Bundespräsident übt sein Vetorecht in der Praxis nicht aus.
Mündige Bürger statt Parteienklüngel
Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich Deutschland, wie viele andere westliche Demokratien auch, in eine Parteienherrschaft verwandelt hat. Regierung und Bundestagsmehrheit sind praktisch ein und dasselbe Organ, die Mehrheitsparteien entscheiden, wer Bundespräsident wird. Abgeordnete, die der Parteilinie bei Abstimmungen nicht folgen, werden über kurz oder lang aussortiert. Wer in der Verwaltung Karriere machen möchte, sollte ein Parteibuch der etablierten Parteien haben. Selbst das Bundesverfassungsgericht ist mittlerweile mit Parteipolitikern durchsetzt, deren einzige fachliche Qualifikation das Zweite Juristische Staatsexamen ist. Stoppen die Gerichte tatsächlich einmal eine Maßnahme der Politik, ändert die Politik eben das Gesetz. Salopp gesagt: Die Bürger müssen alles zahlen, haben aber nichts zu melden, obwohl sie angeblich der Souverän sind. Einmal alle vier Jahre dürfen Sie ein Kreuzchen machen, wobei die obsiegende Partei sich leider nicht an ihr Parteiprogramm halten kann, weil sie in Koalitionsverhandlungen Kompromisse machen muss oder bestimmte Sachverhalte vermeintlich alternativlose Entscheidungen erzwingen.
Der große Vorteil der direkten Demokratie liegt demgegenüber darin, dass die Bürger zu Sachfragen entscheiden und auch Entscheidungen der Politik revidieren können. Sie müssen –anders als die Parteien- dabei auf keine mächtigen Interessegruppen Rücksicht nehmen. Erfahrung der Schweiz und Liechtensteins zeigen, dass die Bürger durchaus in der Lage sind, sich über Sachverhalte angemessen zu informieren, bevor sie ihre Entscheidung treffen. Direkte Demokratie schwächt definitiv die Macht der Politiker und Parteien und ist daher bei diesen so unbeliebt. Aber wer den Bürgern die Kompetenz zur Entscheidung in Sachfragen abspricht, darf sie eigentlich auch nicht wählen lassen. Denn es ist einfacher, eine Sachentscheidung zu fällen als eine Entscheidung über einen Politiker, den man kaum kennt oder über ein langes Parteiprogramm, dessen Umsetzung ungewiss ist[11].
Nun hat die direkte Demokratie auch Nachteile. Es besteht immer die Gefahr, dass die Mehrheit die Minderheit zu eigenen Gunsten enteignet oder bevormundet. Auch die Schweiz ist insofern theoretisch nur eine Volksabstimmung von der Enteignung Ihrer Leistungsträger entfernt. Gesetz und Verfassung bieten keinen wirklichen Schutz, weil diese ebenfalls geändert oder einfach nur anders ausgelegt werden können. Hier hat das liechtensteinische System zwei wirksame Sicherheitsventile eingebaut: zum einen das Vetorecht des Fürsten, zum anderen das Sezessionsrecht der Gemeinden. Ein Missbrauch des Vetorechts durch das Staatsoberhaupt wiederum wird durch die Möglichkeit der Bürger zum Misstrauensvotum oder zur Abschaffung der Monarchie verhindert.
Friedlicher Wettbewerb der Staaten
Liechtenstein ist das einzige Land der Welt, das seinen Gemeinden kraft Verfassung die Sezession und damit die Selbstbestimmung erlaubt. Eigentlich ist dies ein urdemokratischer Vorgang. Die Mehrheit eines Gebietes entscheidet per Volksabstimmung, unabhängig zu werden oder einem anderen Gemeinwesen anzugehören. Dieses Selbstbestimmungsrecht der Völker ist zwar in der UN-Charta verankert. Allerdings wäre das ein enormer Machtbegrenzungsfaktor für die Politik, daher hat sich diese das Dogma der „Unverletzlichkeit der Grenzen“ (natürlich „zur Friedenssicherung“) zurecht gelegt und missachtet das Selbstbestimmungsrecht der Völker einfach. Es ist aber nicht wirklich einsehbar, welche Friedensgefährdung es darstellen soll, wenn sich etwa Gebiete wie Venetien oder Katalonien von ihrem Mutterland lösen (und noch dazu Mitglied von EU und NATO bleiben wollen). In beiden Fällen ist eine große Mehrheit der Bevölkerung für die Abspaltung. Beweggrund ist jeweils, dass man seine Angelegenheiten lieber selber wahrnehmen möchte, schlecht geführte Regionen und den administrativen Wasserkopf der Zentralregierung nicht länger subventionieren will und den Parteien auch nicht zutraut, im Interesse der eigenen Region zu handeln. Das weiß natürlich die Regierung und hat daher in beiden Fällen die Abspaltung verboten. Ob diese undemokratische und autoritäre Haltung auf Dauer gegen den Willen der Bevölkerung durchsetzbar ist, steht freilich auf einem anderen Blatt.
Wäre die Abspaltung zulässig, wie das in Liechtenstein der Fall ist, hätte die Regierung einen Anreiz, die Interessen der Regionen von vornherein stärker zu beachten. Fürst Hans-Adam II. hat erkannt, dass die Gewährung von Selbstbestimmungs- und damit Sezessionsrecht die Qualität staatlichen Handelns kraft Wettbewerb genauso erhöhen kann, wie dies im Produkt- und Dienstleistungsmarkt der Fall ist. Die Staaten müssen dann friedlich miteinander in Wettbewerb treten, um Ihren Kunden den bestmöglichsten Service zum niedrigsten Preis anzubieten[12]. Hans-Adam II. wörtlich: „Der Umwandlungsprozess des Staates vom Halbgott in ein Dienstleistungsunternehmen wird nur möglich sein, wenn man von der indirekten auf die direkte Demokratie übergeht und mit dem Selbstbestimmungsrecht auf Gemeindeebene das Monopol des Staates aufbricht.“[13] In Deutschland hätten sich bei gleicher Rechtslage vermutlich nicht nur die Exklave Büsingen[14], sondern diverse süddeutsche Gemeinden längst der Schweiz angeschlossen. Das hätte wiederum die Politik erheblich vorsichtiger bei ihren Maßnahmen gemacht, denn andernfalls drohte ja ein weiterer Verlust von Staatsgebiet und Staatsbürgern (=Macht).
Die Mehrheit der Entscheidungen auf Gemeindeebene treffen
Ein weiterer Vorteil Liechtensteins ist schlicht seine Kleinheit. Je größer und anonymer eine Gesellschaft ist, desto eher wird sich ein Wasserkopf von Politikern, Beamten und Lobbyisten um die Zentrale bilden und desto eher besteht ein Anreiz, persönlich nicht bekannte Mitmenschen auszubeuten und weltfremde Entscheidung zu treffen. Echte Subsidiarität bedeutet, dass die Mehrheit der Entscheidungen auf Gemeindeebene getroffen werden. Man kennt sich und, kann die Auswirkung seines Tuns direkt beobachten. Ein Sozialkontrolle findet statt[15].
Verglichen mit Deutschland ist Liechtenstein zudem ein Musterbeispiel für Systemrobustheit oder Antifragilität. Ein antifragiles System ist eines, das weniger Ausschläge (auch nach oben) aufweist, dafür über ein weit längeren Zeitraum stabil und letztlich erfolgreicher ist[16]. Den Gegensatz dazu bilden fragile Systeme, die eine Zeit lang gut aussehen, dann aber in regelmäßigen Abständen katastrophal zusammenbrechen. Bis zum Jahr 1866 waren Liechtenstein und das heutige Deutschland im Deutschen Bund vereint. Der Deutsche Bund war ein Staatenbund souveräner deutschsprachiger Staaten, der im wesentlichen eine gemeinsame Verteidigung zum Gegenstand hatte. Ähnlich wie heute der intellektuelle Mainstream und die politische Klasse einen europäischen Bundesstaat anstrebt, war seinerzeit die Schaffung eines einheitlichen deutschen Staates das Maß der Dinge. Als nach der Schlacht von Königgrätz klar wurde, dass Preußen, welches den Fortbestand des Deutschen Bundes ablehnte, das Zentrum dieses neuen Staates sein würde, wurde von den Mitgliedsstaaten seine Aufhebung beschlossen. Ein einziges Land stimmte damals übrigens dagegen: Liechtenstein.
Was in der Folge mit Deutschland geschah ist bekannt: Einigungskriege, Kolonialismus, Erster Weltkrieg, zwei Millionen eigene Kriegstote, Verlust von einem Viertel des Staatsgebietes, Revolution, Hyperinflation, Währungsreform mit Verlust nahezu alle Ersparnisse, nationalsozialistische Diktatur, Zweiter Weltkrieg, Holocaust mit Auslöschung der jüdischen Mitbürger und ihrer Kultur, sechseinhalb Millionen eigene Kriegstote, Verlust eines weiteren Drittels des Staatsgebietes, fast alle Städte zerbombt, Vertreibung von zwölf Millionen Deutschen, Teilung des Landes in Besatzungszonen, erneute Währungsreform mit Verlust nahezu aller Ersparnisse, sozialistische Diktatur im Ostteil, dort Revolution und erneute Währungsreform. Insgesamt gab es sage und schreibe vier Systemzusammenbrüche seit 1870. Demgegenüber in Liechtenstein: null.
Eine der innovativsten Verfassungen der Welt
Heute verfügt Liechtenstein über ein weit höheres Pro-Kopf-Einkommen als Deutschland, ist ein stabiles Land mit wenig Kriminalität und ohne Staatsschulden. All dies wurde erreicht ohne einen einzigen Krieg, ohne eine einzige Revolution und ohne einen einzigen Anschluss an ein großes und mächtiges Gemeinwesen. Wenn dieser Erfolg nicht am politischen System und an der Kleinheit des Landes liegt, woran dann?
Wir sollten daher auch darüber nachdenken, ob ein Europa aus 100-200 Liechtensteins nicht das bessere Europa wäre. Die meisten Entscheidungen würden auf lokaler Ebene und dezentral getroffen, die Bürger dürften in Sachfragen mitentscheiden und aufgrund der Vielzahl von Gemeinwesen und des Sezessionsrechts herrschte ein fruchtbarer Wettbewerb um die Bürger anstelle eines Staatenkartells, dass die Bürger einerseits möglichst weitgehend melken und andererseits von allen Entscheidungen ausschließen will. Europas Stärke war immer die Vielfalt und der damit verbundene Wettbewerb. Die Schaffung gemeinsamer Institutionen wie einer gemeinsamen Freihandels- oder Wirtschaftszone oder einer gemeinsamen Verteidigung steht dem nicht entgegen. Je kleiner die Staaten sind, desto weniger droht zudem ein einzelner oder eine Gruppe von Staaten zu dominant zu werden. Nur Großmächte können große Katastrophen anrichten. Leopold Kohr, der „Philosoph der Kleinheit“, stellte bereits 1941 fest, was heute unverändert gilt: „Die politische Theoretiker unserer Zeit, die nur das Große im Auge haben und sich an Sammelbegriffen wie „Menschheit“ begeistern (niemand weiß, was das eigentlich ist und warum man für sie Leben opfern soll) halten den bloßen Gedanken, mehr anstatt weniger Staaten zu schaffen, für einen Rückschritt ins Mittelalter. Sie alle sind für Einigung und Gigantismus, obwohl Einigung über gewisse Grenzen hinaus nichts darstellt als totalitäre Gleichschaltung… Es ist …unsere eigene Erfahrung, die uns gelehrt hat, dass die Demokratie in Europa oder sonstwo nur in kleinen Staaten blühen kann. Nur dort kann der Einzelmensch seinen Platz und seine Würde behaupten“[17].
Natürlich ist auch in Liechtenstein nicht alles Gold was glänzt. Auch dort wachsen die Verwaltung und die Staatsausgaben beständig. Im Jahre 1956 verfügte Liechtenstein gerade einmal über zwölf Polizisten und man konnte den Regierungschef anrufen, worauf dieser persönlich das Telefon abnahm und sich mit „Regierung“ meldete[18]. Heute hat allein die Liechtensteiner Polizei 120 Mitarbeiter und das Land eine „professionelle“ Regierung und Verwaltung mit 19 Ämtern, 27 Dienststellen und weiteren Einrichtungen. Die Steuern sind entsprechend gestiegen. Jede Verwaltung tendiert dazu, sich zu erweitern und jedes Parlament tendiert dazu, seine Aufgabenbereiche auszuweiten, jeweils um die eigene Bedeutung zu vergrößern. Vernünftig klingende Gründe finden sich dafür immer. Eine echte Dienstleistungsgesellschaft beruht aber auf Freiwilligkeit. Jeder bezahlt nur für die Dienstleistung, die er auch haben will. Ansonsten besteht eben die Gefahr, immer neue staatliche „Dienstleistungen“ und Mitgliedschaften in „wichtigen internationalen Organisationen“ aufgedrängt zu bekommen, weil Staatsoberhaupt/ Parlament/ Regierung / Mehrheit des Volkes der Meinung sind, das sei gut für einen. Dem wäre dadurch zu begegnen, dass jeder einzelne Bürger sozusagen als Souverän seiner selbst einfach ein Vertrag mit dem „Dienstleistungsunternehmen Staat“ schließt, in dem festgehalten ist, was seine Rechte und Pflichten (einschl. Kosten) sind, so dass ein Parlament oder die Mehrheit nicht einseitig diesen Vertrag ändern kann. Darin kann durchaus eine nicht verhandelbare Basisleistung wie Polizei /Justiz / Grundsicherung enthalten sein. Aber wer weiß, vielleicht wird Liechtenstein auch in dieser Hinsicht einmal eine Vorreiterrolle einnehmen.
Die aktuelle Landesverfassung ist jedenfalls eine der innovativsten der Welt, was die Machtbegrenzung angeht, und das ist in jedem System der alles entscheidende Punkt.
Dieser Artikel erschien erstmals beim Deutschen Arbeitgeber Verband.
[1] Eine Änderung des bundesdeutschen Systems ist einfacher als viele denken. Tatsächlich müssten die erwachsenen Staatsbürger nur mit einfacher Mehrheit eine neue Verfassung verabschieden. Damit wäre das Grundgesetz gegenstandslos. [2] Einer altmodischen Auffassung zufolge sollte man keine laute und lärmende Meinung zu Sachverhalten vertreten, über die man erkennbar nicht ausreichend informiert ist. [3] http://www.llv.li/files/as/Jahrbuch%202014%20internet_gesamt.pdf, 167 [4] https://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaft_Liechtensteins [5] http://www.liechtenstein.li/wirtschaft/zahlen-und-fakten/ – Gesamt-BIP geteilt durch die Zahl der Arbeitsplätze [6] http://de.statista.com/statistik/daten/studie/254144/umfrage/bruttoinlandsprodukt-je-erwerbstaetigen-in-deutschland-nach-bundeslaendern/ [7] David Beattie, Liechtenstein. Geschichte und Gegenwart, Triesen 2005, 219ff. [8] Beattie, 228f. [9] Beattie, 227 [10] Hans-Adam II. von Liechtenstein, Der Staat im dritten Jahrtausend, Bern 2010, 169 [11] Hans-Adam, 177 [12] Hans-Adam, 166 [13] Hans-Adam, 196 [14] https://de.wikipedia.org/wiki/Büsingen_am_Hochrhein: „Im Jahre 1918 wurde eine Volksabstimmung durchgeführt, in der 96 % der Büsinger Bürger für eine Angliederung ihres Dorfes an die Schweiz stimmten. Dazu kam es aber nicht, weil die Schweiz kein geeignetes Austauschgebiet anbieten konnte. So blieb Büsingen beim Deutschen Reich. Die bisher letzte Chance der Büsinger, der Schweiz angegliedert zu werden, bot sich 1956. Damalige Verhandlungen waren zunächst vielversprechend, jedoch bestand der Landkreis Konstanz auf dem Verbleib von Büsingen bei Deutschland.“ Was die Bürger von Büsingen selbst wollen, spielt für den deutschen Staat offenbar keine entscheidende Rolle. [15] Vgl. dazu auch Hans-Adam II., 11-23. [16] Nassim Nicholas Taleb, Antifragilität – Anleitung für eine Welt, die wir nicht verstehen, München 2013. [17] Leopold Kohr, Die Lehre vom rechten Maß, Salzburg 2006, 26f. [18] Kohr, 147f.