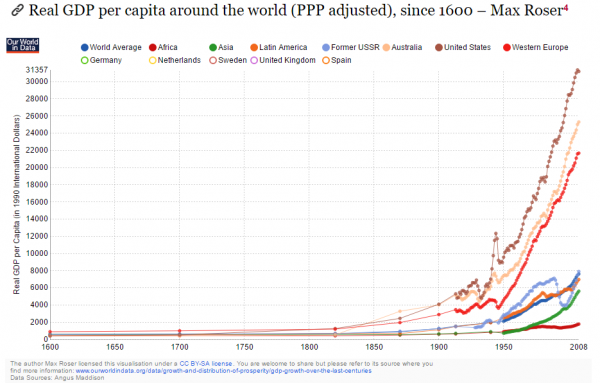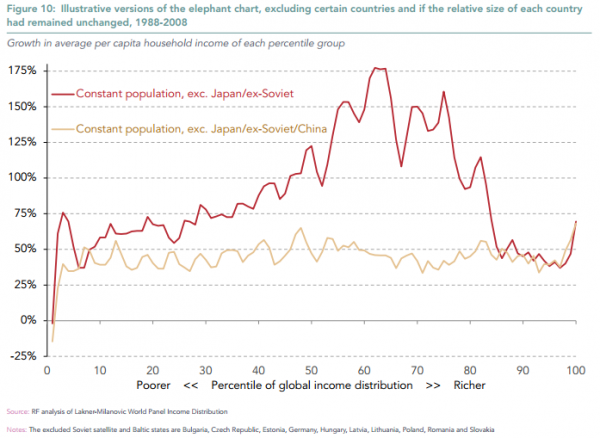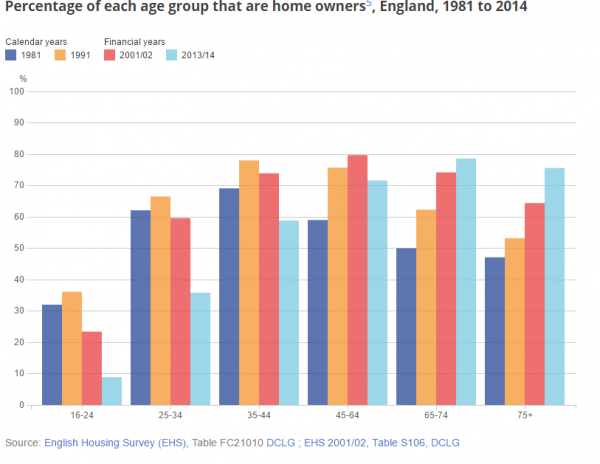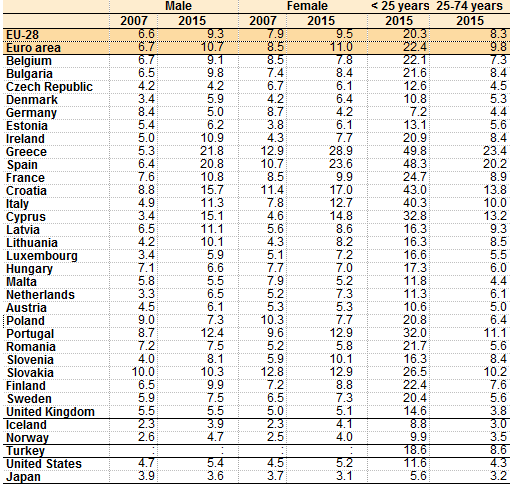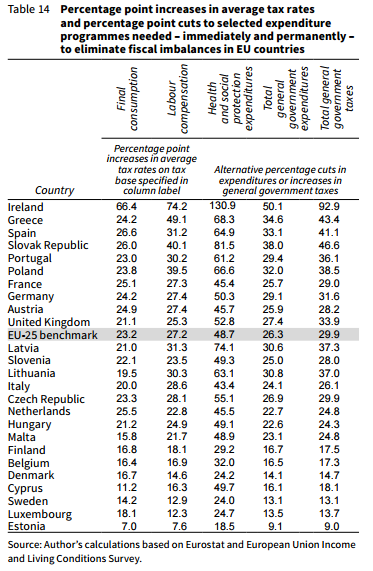Photo: Fraktion DIE LINKE. im Bundestag from Flickr (CC BY 2.0)
Ein Chlorhühnchen nach dem anderen wird wie die sprichwörtliche Sau durchs Dorf gejagt. Neben dem guten Gefühl, auf der richtigen Seite zu stehen, zahlt sich das für die großen Panikmacher auch finanziell aus. Wieviel „Profitgier“ steckt in der Hysterie-Industrie?
Ein blühendes Geschäft
Campact, Attac, Greenpeace, Deutsche Umwelthilfe – die Bilanzen dieser Unternehmen lesen sich respektabel: Greenpeace nahm im letzten Jahr 57,7 Mio. Euro ein, die Deutsche Umwelthilfe (DUH) folgt mit 8,3 Mio., Campact mit 7 Mio. und schließlich Attac mit 1,8 Mio. Die DUH, Campact und sogar Attac fallen damit gemäß der Definition des Instituts für Mittelstandsforschung in Bonn in die Kategorie „mittlere Unternehmen“, während Greenpeace sogar als Großunternehmen gilt. Das Geschäft blüht: Campact etwa hat seine Einnahmen von etwa 2 Mio. in den Jahren 2011 und 2012 auf die 7 Mio. heute kontinuierlich und eindrucksvoll gesteigert.
Wie sich die einzelnen Kampagnen-Unternehmen finanzieren, unterscheidet sich durchaus. Am dubiosesten ist sicherlich die DUH unterwegs. Als sie vor einigen Jahren eine Kampagne zur Dieselfilter-Pflicht durchführten, wurde öffentlich, dass sie von Partikelfilterherstellern 100.000 Euro eingesammelt hatten. Neben diesen blanken Lobbyismus tritt dann noch die klassische Abmahn-Abzocke gerade von kleinen mittelständischen Unternehmen, wodurch im letzten Jahr 2,3 Mio. Euro direkt in ihre Kassen flossen. Im Jahresbericht wird diese Masche dann blumig umschrieben mit den Worten „Hinzu kommen Einnahmen des Verbraucherschutzes, die zum größten Teil aus der Kontrolle von Unternehmen stammen, die gegen die Regeln der Energieverbrauchskennzeichnung verstoßen haben.“
Der einfache Bürger öffnet sein Portemonnaie
Greenpeace und Campact nutzen solche Methoden nicht und finanzieren sich fast ausschließlich aus Spenden. Sie nehmen – das hat durchaus Anerkennung verdient – weder Gelder von der Industrie noch von der öffentlichen Hand. Attac schreibt auf seiner Website, dass sie sich „bei größeren Projekten auch durch die Akquise von Drittmitteln (öffentliche, kirchliche oder private Förderorganisationen)“ finanzieren. Ihre Finanzberichte weisen das freilich nicht auf. Prinzipiell könnte man den Impuls, sich durch Kleinspenden die Unabhängigkeit zu bewahren, für sehr lobenswert halten. Man könnte Respekt haben vor der Leistung, Hunderttausende von Spendern zum Einsatz zu motivieren.
Oder man könnte das ganze einmal durch die Logik-Brille der Agitatoren dieser Organisationen betrachten. Stellen Sie sich einmal vor, es gäbe die Organisation „Marketpeace“, die sich durch hunderttausende von Kleinspenden finanziert. Man kann darauf wetten, dass sofort die Vorwürfe laut würden, dass hier einfache Bürger übers Ohr gehauen werden mit gefälschten Studien, tendenziösen Vereinfachungen und blanken Lügen. Man würde Marketpeace Manipulation und Täuschung vorwerfen mit dem Ziel, die eigenen Taschen zu füllen.
Profit- und Panikmache
Mit Slogans wie „Ceta ist brandgefährlich“ (Greenpeace), „Für ein anderes Europa – ohne Austerität und Rassismus!“ (Attac) und „TISA – Stoppt den Geheimplan der Konzerne“ (Campact) bewegen sich die Organisationen nicht nur auf dem vielgescholtenen „Bild-Zeitungs-Niveau“. Sie arbeiten auch vornehmlich mit Ängsten. Da wird mit einem Begriff wie „brandgefährlich“ an menschliche Fluchtinstinkte appelliert. Da werden „neoliberale Politik und die globalisierte kapitalistische Ökonomie“ in einer bizarren Volte mit Rassismus in Zusammenhang gebracht. Und da wird von „Geheimplänen“ gemunkelt, als hätte sich Campact mit dem Verschwörungstheoretiker-Magazin „Compact“ zusammengetan. Das ist Panikmache. Das ist verantwortungslose Polemik. Das ist Manipulation erster Güte, die mit den Ängsten von Menschen spielt, um sie auf die eigene Seite zu ziehen und so die Kampfkassen zu füllen.
Profitgier kann sehr unterschiedliche Züge annehmen. Derzeit werden wir beispielsweise wieder sehr deutlich daran erinnert, welche Blüten sie im Bankensektor getrieben hat und noch treibt. Profitgier ist übertriebenes Eigeninteresse und uns aus gutem Grund zuwider. Aber Profitgier muss sich nicht notwendigerweise auf Geld beziehen. Der Profit, den jemand gierig verfolgt, kann etwa auch in gesellschaftlicher Anerkennung bestehen, in der Zahl von Anhängern oder in der Durchsetzung der eigenen Vorstellungen. All das sind auch Profite. Man kann sie auf normalem Wege verfolgen und viele tun das auch, ohne dass es uns anstößig vorkommen würde. Man kann Profit aber auch in einer Haltung der Gier verfolgen, wenn man immer mehr davon will und immer weniger Rücksichten zu nehmen bereit ist.
Ängste statt Argumenten
Obwohl manche der Beschäftigten in den angeführten Organisationen nicht schlecht verdienen, häufen sie doch keine Reichtümer an. Viele von ihnen sind wahrscheinlich Idealisten, für die Geld nur eine untergeordnete Rolle spielt. Oberflächlich betrachtet wäre es also eigenartig, ihnen Profitgier vorzuwerfen. Ihre Gier bezieht sich aber auf eben diese nicht-materiellen Werte. Sie haben bereits früher Zehntausende gegen TTIP und CETA auf die Straße gebracht – nun sollen es Hunderttausende sein. Sie haben die eine Partei vor sich hergetrieben – nun soll die nächste an die Reihe kommen.
Von dieser Gier getrieben ist ihnen jedes Mittel recht: Verkürzungen und Verunglimpfungen, Hohn und Hysterie, Parolen und Propaganda. Sie wittern Verschwörungen, schwingen sich zu Fürsprechern der „kleinen Leute“ auf und schüren Ressentiments gegen Unternehmer und Konzerne. Sie arbeiten mit Ängsten statt mit Argumenten und bereiten so den Boden für die Gegner von Marktwirtschaft und offener Gesellschaft auf allen Seiten des politischen Spektrums. Insofern sind sie tatsächlich Gesellschaften mit beschränkter Haftung: denn die Folgen werden vergemeinschaftet. Sehr schade, denn Kritik ist wichtig – bei der Kontrolle von Regierungshandeln wie beim Schutz der Umwelt und vielen anderen Anliegen, die allen Menschen zugutekommen würden.